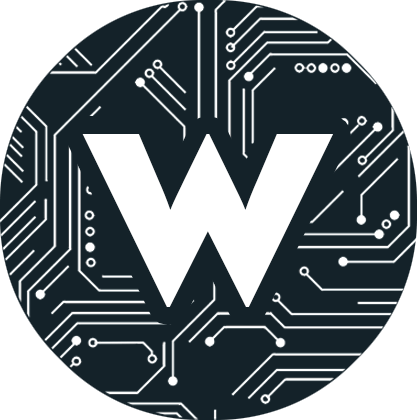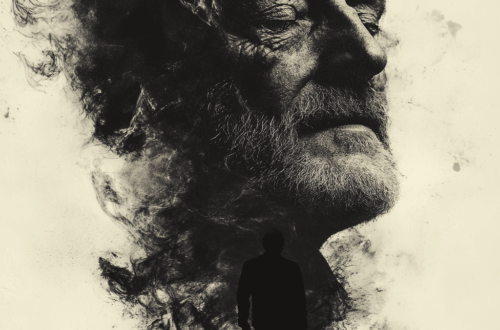„Die Hemmschwelle zur digitalen Hassrede scheint niedriger zu sein“
Dr. Jana Büchter hat in ihrer juristischen Dissertation an der Universität Münster erforscht, ob das bestehende Strafrecht dem Phänomen „Hate Speech“ im Internet inhaltlich und hinsichtlich der Strafzumessung gerecht wird. Die Antwort, die die Rechtsanwältin in ihrer Arbeit gibt, ist: Ja, die bestehenden Gesetze reichen auch in der digitalen Welt aus. Im Interview mit Hanna Dieckmann weist sie darauf hin, warum es bei Teilaspekten wie der erschwerten Strafverfolgung dennoch wichtig ist, achtsam zu sein und gegebenenfalls nachzuschärfen.
Wie wird das Phänomen „Hate Speech“ im Internet aktuell juristisch eingeordnet?
,Hate Speech‘ ist kein eigener Straftatbestand im deutschen Recht. Stattdessen können solche Äußerungen – je nach Inhalt – unter bestehende Tatbestände wie Beleidigung, Verleumdung oder Volksverhetzung fallen. Sie werden damit gesetzlich genauso behandelt wie das Pendant im realen öffentlichen Raum. Hassrede im Internet kann jedoch andere, schlimmere Konsequenzen haben – etwa durch größere Reichweite und die Gefahr von Vervielfältigung. Gerichte haben im Rahmen der Strafzumessung die Möglichkeit, die besonderen Auswirkungen digitaler Hassrede straferschwerend zu berücksichtigen.
Inwiefern hat Hassrede im Netz schlimmere Konsequenzen als auf der Straße?
Durch die größere Reichweite, Anonymität, Dynamik und die Möglichkeit der schnellen und weiten Vervielfältigung hat ,Hate Speech‘ im Gegensatz zur klassischen Beleidigung eine stärkere gesellschaftliche Wirkung. Wenn eine Person im Internet beleidigt oder verunglimpft wird, dann kann sich das wie ein Lauffeuer verbreiten. Die Hemmschwelle zur digitalen Hassrede scheint niedriger zu sein. Das kann zur Verbreitung von Gewaltbereitschaft führen, Opfer einschüchtern und Betroffene dazu bringen, sich aus der öffentlichen Kommunikation zurückzuziehen. Dieser Dynamik müssen Gerichte bei der Urteilsfindung Rechnung tragen, indem sie insbesondere die konkreten Folgen für die Betroffenen im Rahmen der Strafzumessung bewerten.
Was Sie beschreiben, klingt danach, als gäbe es sehr wohl gute Gründe, digitale Hetze als eigenen Tatbestand zu betrachten.
Die Unterschiede in der Art, wie die Taten ausgeführt werden und welche Konsequenzen sie haben, sind deutlich. Aber in solchen Fällen neigt der Gesetzgeber oft dazu, aktionistisch zu handeln. Das birgt die Gefahr, ein neues Gesetz zu schaffen, das inhaltlich zu weit gefasst und unbestimmt ist – mit potenziell kontraproduktiven Folgen, etwa für die Meinungsfreiheit. Daher komme ich in meiner Doktorarbeit zu dem Ergebnis, dass die bestehenden Straftatbestände grundsätzlich ausreichen und die Gerichte genügend Handlungsspielraum haben, um die besonderen Umstände und die Schwere digitaler Hassrede angemessen zu berücksichtigen.
Hassrede im Netz ist ein vergleichsweise neuer Tatbestand. Seit wann beschäftigt sich der Gesetzgeber damit?
Der Begriff ,Hate Speech‘ stammt uaus dem angloamerikanischen Raum. Im deutschen Strafrecht gibt es jedoch keine eigenständige Definition oder einen speziellen Tatbestand dafür. Es handelt sich um Äußerungen, die darauf abzielen, eine Person oder Gruppe zu verletzen, zu schikanieren oder zu herabwürdigen – unter Umständen auch mit einem Aufruf zu Gewalttaten. 2017 wurde das Netzwerkdurchsuchungsgesetz (NetzDG) eingeführt. Es verpflichtet die Betreiber sozialer Netzwerke dazu, strafbare Inhalte wie Hassrede innerhalb kurzer Fristen zu löschen. Zuvor hatten sich die Stimmen gemehrt, digitale Hassrede stärker zu regulieren – auch wenn das NetzDG eher medien- und ordnungsrechtlich ausgerichtet ist und nicht das Strafrecht selbst betrifft.
Wie steht es um die Strafverfolgung von Taten im Internet?
Das ist ein großes Problem, denn der Schutz der Privatsphäre ist ein hohes Gut. Dieser Schutz fördert die freie Meinungsäußerung, indem er verhindert, dass persönliche Daten oder Identitäten ohne Weiteres offengelegt werden müssen. Gleichzeitig kann diese Anonymität von Cyberkriminellen missbraucht werden, um Straftaten im Netz zu begehen, ohne identifiziert zu werden. Zum Beispiel nutzen Täter häufig gefälschte Profile, also ,Fake-Accounts‘, um die eigene Identität zu verschleiern. Für die Strafverfolgungsbehörden bedeutet das: Klassische Ermittlungsansätze greifen oft nicht, und die Aufklärung solcher Taten gestaltet sich entsprechend schwierig.
Was schließen Sie daraus?
Die Regulierung von Anonymität, Klarnamenpflicht und Inhaltskontrolle im Internet befindet sich in einem komplexen Spannungsfeld. Einerseits müssen die Rechte auf Privatsphäre und freie Meinungsäußerung geschützt werden, andererseits ist eine effektive Strafverfolgung gegen Cyberkriminalität und digitale Hassrede erforderlich. In der Praxis die richtige Balance zu finden, ist entsprechend schwierig. Im Spannungsfeld aus Grundrechten, Interessenlagen und Strafgewalt des Staates lässt sich auch die Strafbarkeit von ,Hate Speech‘ im Internet verorten. Es ist ein dynamischer Bereich, der die Rechtswissenschaften, die Kriminalverfolgung und die Justiz auch zukünftig beschäftigen wird, um einen richtigen und rechtmäßigen Umgang beizubehalten.
Quelle: Pressemitteilung der Universität Münster, 18. Juni 2025