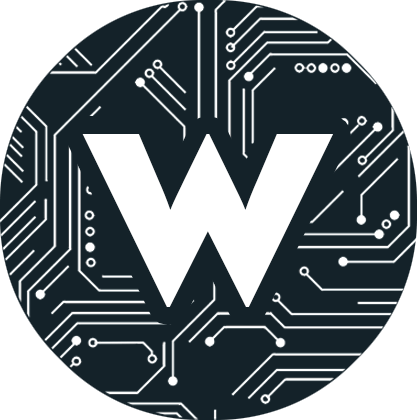Medien benennen Minderheiten häufiger
In Medienberichten wird die Zugehörigkeit von Personen zu Minderheiten auffallend oft erwähnt, etwa ihre Herkunft oder nationale Zugehörigkeit. Bei Mehrheitsangehörigen geschieht das deutlich seltener. Dieser Unterschied wird häufig als Ausdruck von Vorurteilen gedeutet. Eine neue Studie aus der Sozialpsychologie der Ruhr-Universität Bochum kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis.
Ein Forschungsteam um die Psychologin Anna Schulte untersuchte in mehreren Studien mit insgesamt über 900 Teilnehmenden, warum bestimmte Merkmale in Berichten häufiger auftauchen als andere. Der zentrale Befund: Menschen neigen grundsätzlich dazu, seltene oder auffällige Informationen eher wahrzunehmen und weiterzugeben als häufige, „normale“ Merkmale. Dieses kognitive Prinzip der Differenzierung wirkt unabhängig von bewussten Einstellungen gegenüber Minderheiten.
In einer der Studien erhielten Teilnehmende eine fiktive FBI-Pressemitteilung zu einem Vorfall mit Täterbeschreibung. Die Herkunft der beschriebenen Person wurde systematisch variiert: Entweder gehörte sie zur gesellschaftlichen Mehrheit oder zu einer Minderheit. Anschließend sollten die Teilnehmenden daraus einen kurzen Nachrichtenbericht formulieren. Das Ergebnis war deutlich: Die Herkunft wurde mehr als dreimal so häufig erwähnt, wenn die Person einer Minderheit angehörte.
Um auszuschließen, dass es sich um einen rein negativen Effekt handelt, wiederholte das Team das Experiment mit positiven Ereignissen wie Lottogewinnen oder wissenschaftlichen Erfolgen. Auch hier zeigte sich derselbe Effekt – sogar noch stärker. Minderheitenmerkmale wurden deutlich häufiger genannt, obwohl der Kontext positiv war.
Zusätzlich untersuchten die Forschenden, wie künstliche Intelligenz mit solchen Informationen umgeht. Sechs große Sprachmodelle, darunter auch bekannte KI-Systeme, erhielten dieselben Aufgaben. Sie nannten Minderheitenzugehörigkeiten noch häufiger als menschliche Teilnehmende. Die Vermutung: KI-Modelle übernehmen statistische Muster aus ihren Trainingsdaten und verstärken bestehende Kommunikationstendenzen.
Die Forschenden sprechen von einem „Minderheitendilemma“. Zwar liegt keine bewusste Abwertung vor, dennoch führt die häufige Hervorhebung dazu, dass Minderheiten in Medien überproportional sichtbar werden – besonders in negativen Kontexten. Für den Journalismus ergibt sich daraus eine schwierige Frage: Weder das konsequente Weglassen noch das ständige Nennen aller Merkmale ist eine einfache Lösung. Die Studie macht deutlich, dass bewusster Umgang mit Sprache wichtiger ist denn je – gerade auch beim Einsatz von KI in Redaktionen.